Mit der frischgebackenen Mama habe ich heute einen ganz besonderen Gast aus meinem Blog. Als ich ihr angeboten hatte einen Geburtsbericht auf meinem Blog zu veröffentlichen, habe ich erst vermutet, dass es ja irgendwie „nicht soo tragisch“ werden kann. Ich hab ja schon einiges gelesen und fühlte mich gewappned. . Ein schönes Pendant zu meinem Geburtstrauma – dachte ich mir. Schließlich gab es wohl ein Happy End. Weit gefehlt. Beim Lesen kamen mir die Tränen. Diese Mama hat so viel mitgemacht, ist quasi durch die Hölle gegangen und wieder zurück. Und hat das alles scheinbar mühelos gepackt. Ich bin mir sicher, auch sie hat ihre Narben davongetragen, aber sie wirkt einfach unglaublich stark, sodass ich mich schon fast schäme, dass ich meinen Notkaiserschnitt nicht so souverän gepackt habe. Liebe Schwangeren Mamas: Das ist absolut harte Kost, bitte lest den Text nicht, wenn ihr Unsicherheiten in der Schwangerschaft erlebt habt oder Angst vor der Geburt habt.
Ganz ganz lieben Dank an die Frischgebackene Mama für deinen ausführlichen Bericht!
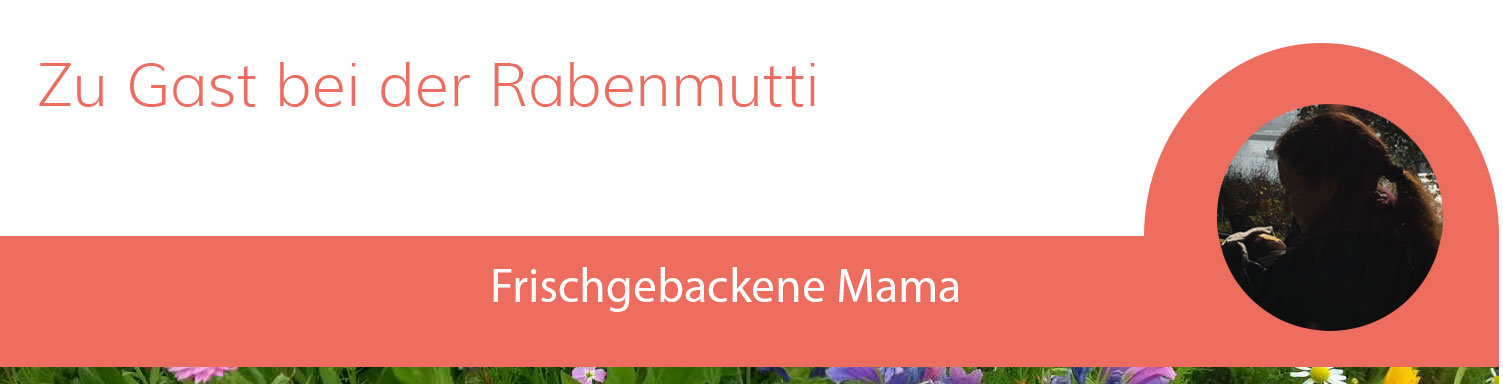
Danke für mein Leben und das meiner Tochter, liebe Klinikmitarbeiter
Dies ist ein Bericht über eine positive Krankenhauserfahrung trotz traumatischer Geburt. Um es vorwegzunehmen: Frühgeburt mit Notkaiserschnitt. Die Geburt selbst soll aber nicht im Fokus stehen, sondern der Weg dorthin und vor allem die Ärzte, Schwestern und Hebammen, die mich auf diesem Weg begleitet haben. Leider kann ich mich aufgrund der Aufregung in dieser Zeit an keine Namen mehr erinnern. Aber ich hoffe, ihnen mit diesem Text dennoch Respekt zollen und Dankbarkeit ausdrücken zu können.
Auf meine Ankündigung auf Twitter, einen Text über gute Krankenhauserlebnisse bei der Geburt zu schreiben, gab es viel positives Feedback. Ein genannter Grund: Zu viele Horrorstories im Web, die den Eindruck erwecken, in deutschen Krankenhäusern läuft es immer schief. Yasmin bietet mir netterweise den Platz, zu diesem Thema mal ein Gegenlicht zu setzen und auf das herausragende Engagement aufmerksam zu machen, das die Klinikmitarbeiter meiner Geschichte an den Tag gelegt haben und jeden Tag aufs Neue zeigen.
Die erste Besichtigung der Geburtsklinik: anders als geplant
Den Plan, in einem Klinikkonzern zu entbinden, hatte ich früh. Den konnte mir auch die wohlmeinende Hebamme aus dem Geburtsvorbereitungskurs nicht ausreden. Wenn wir heute doch die beste medizinische Versorgung vor der Tür haben – warum nicht in Anspruch nehmen. Im Fall von Komplikationen ist man schon an Ort und Stelle. Und wenn es auf natürlichem Wege problemlos klappt, umso besser. Sterile Krankenhausumgebung war für mich kein relevantes Gegenargument.
Die beste medizinische Versorgung vor der Tür zu haben, das konnte man bei mir auch wörtlich nehmen. Wir waren im Mai 2016 gerade umgezogen und wohnen seitdem fußläufig der Asklepios Klinik Altona mit dem Perinatalzentrum (PNZ). Die Klinik war nicht nur fachlich meine erste Wahl, sondern auch praktischerweise auch die dichteste. Ich landete allerdings früher dort als geplant und mir lieb war. An einem „Tag der offenen Tür“ konnten mein Freund und ich wegen dem Umzug und viel Arbeit noch nicht teilnehmen – und so gingen wir das erste Mal durch die Türen des PNZ, als wir in SSW 32+0 wegen Verdacht auf Blasensprung am Abend meines letzten Arbeitstags (danach zwei Wochen Resturlaub, dann Mutterschutz) zum „Abchecken“ hingefahren sind. Den ganzen Tag über verlor ich immer mal wieder etwas Flüssigkeit, hoffte aber auf Schwangerschaftsinkontinenz. Auch die diensthabende Gynäkologin erwartete einen negativen Befund beim Test – doch leider Fehlanzeige.
So verständnisvoll und zuvorkommend wir zuvor empfangen und ich zum CTG gebracht wurde, so verständnisvoll und souverän wurde mir nach der gynäkologischen Untersuchung mitgeteilt, was der Befund bedeutete: Dass ich an diesem Abend und überhaupt vorerst das Krankenhaus nicht verlassen kann; dass die nächsten 48 Stunden entscheidend sind, weil ich Lungenreifespritzen bekomme, die in dieser Zeit ihre Wirkung entfalten; dass ich starke Wehenhemmer mit nicht unerheblichen Nebenwirkungen einnehmen muss und jeder weitere Tag, an dem das Baby im Bauch bleibt, zählt.
„Irgendwie haben die Ärztin und die Hebamme es geschafft, mir an diesem Abend auf eine Weise zu vermitteln, dass mein Baby jederzeit und damit viel zu früh auf die Welt kommen könnte, die mich die Informationen verarbeiten ließ ohne dabei in Panik auszubrechen. Wenn ich mich recht erinnere, mit den beruhigenden Argumenten: selbst wenn es jetzt käme, überlebt es mit größter Wahrscheinlichkeit und das ohne irgendwelche Schäden.“
Trotzdem, klar, habe ich geweint. Denn abgesehen davon, dass ich Angst um mein Baby hatte, war ich gefühlsmäßig vollkommen überfordert, weil ich gedanklich noch gar nicht richtig auf die Geburt und Muttersein eingestellt war. Durch die stressigen vorangegangenen Wochen im Job und den Umzug blieb dafür keine Ruhe (jetzt weiß ich es besser, dass ich die Verantwortung habe, für Ruhe zu sorgen – meines Kindes zuliebe).
Ab jetzt: Risikoschwangere mit strikter Bettruhe, bei der jeder Tag zählte
Noch in der Nacht bin ich also auf die Station der Risikoschwangeren gekommen. Auch hier waren Ärzte, Schwestern und Hebammen super und die 48 Stunden überstand ich gut. Die Menge an Flüssigkeit, die ich verlor, hielt sich in Grenzen, und das CTG war jeden Tag einwandfrei. Daher hoffte ich, das Baby noch bis zur 34. Woche im Bauch zu behalten. Dann hätten die Ärzte es bei einem Blasensprung in jedem Fall geholt, so sagten sie, da das Wasser in diesem Stadium wohl nicht mehr reichen würde. Ich bekam weiter Wehenhemmer und auch Antibiotika. Meine Bettnachbarin war super nett, wir haben heute noch Kontakt, und daher ging es mir eigentlich ganz gut.
Merkwürdige „Schwangerschaftsbeschwerden“ kamen dazu
Ab der dritten Nacht plagten mich plötzlich Sodbrennen und Kurzatmigkeit, was ich aber auf normale Schwangerschaftssymptome schob beziehungsweise Nebenwirkungen der Medikamente. Auch eine Hebamme, die ich fragte, schätzte das so ein. Ich bekam aber etwas gegen das Sodbrennen. Dass ich nicht schlafen konnte, hielt ich auch für normal, denn das kann ich in Krankenhäusern generell nicht und mit dem dicken Bauch noch schlechter. In der vierten Nacht ging es mir dann jedoch richtig elend. Die Kurzatmigkeit wurde schlimmer und es kam auch noch Schüttelfrost dazu beziehungsweise ein Zittern, was ich dafür hielt. Deshalb bat ich die Schwester bei der Frühschicht, meine Vitalwerte sofort und umfangreich zu prüfen. Dabei kam raus: Um meine Sauerstoffsättigung war es schlecht bestellt, trotz guter Versorgung des Babys im CTG. Dann ging alles ganz schnell…
Ich wurde erst einmal in den Kreißsaal gebracht und dort mit Sauerstoff versorgt, denn woanders gab es im PNZ keine geeigneten Geräte. Für die weitere Behandlung musste ich in die Notaufnahme. Dazu musste ich vom Perinatalzentrum ins Hauptgebäude der Klinik gebracht werden. Eine Hebamme begleitete mich auf diesem Weg und blieb auch im Hauptgebäude noch eine ganze Weile bei mir. Sie schrieb die ganze Zeit über ein CTG, um sicherzugehen, dass das Baby in Ordnung ist. Sie hielt meine Hand, sie beruhigte mich. Das war vor allem deshalb wichtig, weil es im Hauptgebäude deutlich ruppiger zuging als im PNZ. Wenn es um mich allein gegangen wäre, hätte ich damit kein Problem gehabt. Aber aufgrund meiner Sorgen und Hormone hatte ich ein ziemlich dünnes Nervenkostüm. Was total toll war:
„Die Mitarbeiter der Hauptklinik hatten vollstes Verständnis und banden die Hebamme bestmöglich mit ein. Als diese sagte: Ich kann nicht viel machen, ich bin ja nur Hebamme, antwortete ein Assistent: So ein Quatsch, ihr macht den wichtigsten Job überhaupt – davor haben wir Respekt!“
In der Notaufnahme wurde ich gründlich untersucht und ich bekam etwas zum Inhalieren, was meine Sauerstoffsättigung kurzfristig wieder verbesserte. Anschließend wurde meine Lunge geröntgt, da der Verdacht einer Lungenentzündung oder gar Lungenembolie bestand, also eine Verstopfung eines Blutgefäßes der Lunge. Die Entzündung konnte im Röntgenbild nachgewiesen werden, wenn auch eine unkonventionelle Art: Wasser in der Lunge, denn Husten hatte ich keinen. Auf Lungenembolie konnte ich nicht weiter untersucht werden, da Methoden wie CT oder MRT bei Schwangerschaft nicht möglich sind wegen schädigender Strahlung. Da die Therapie jedoch die gleiche gewesen wäre – Antibiotika und ein Medikament zur Entwässerung – musste das auch nicht weiterverfolgt werden. Von der Notaufnahme wurde ich in die Kardiologie gebracht, wo mein Herz untersucht wurde. Da war aber zunächst alles in Ordnung.
Intensive Betreuung bis zur Geburt
Das besagte Medikament zur Entwässerung wurde mir gleich verabreicht und man verlegte mich zur besseren Beobachtung auf die Intensivstation, denn die Kurzatmigkeit und das Zittern hielten an. Ein Ultraschall wurde durchgeführt, der darauf schließen ließ, dass sich durch die Schwangerschaft ein Hohlraum in der Lunge gebildet hat, in den Wasser eingedrungen ist – ein guter Nährboden für Viren, die die Entzündung ausgelöst haben. Da es Viren und keine Bakterien waren, blieb die Entzündung bei meinen Blutchecks unentdeckt. Mein Körper hatte große Mühe, gegen die Lungenentzündung anzukämpfen und gleichzeitig das Kind zu versorgen. Aufgrund der wieder abfallenden Sauerstoffsättigung bekam ich Sauerstoff über die Nase verabreicht. Ich erlebte hier zwei Intensivpflegerinnen, die mich tief beeindruckt haben. Die erste betreute mich tagsüber am Sonntag, dem vierten vollen Tag seit meiner Aufnahme. Sie machte mich frisch, bettete mich mit Engelsgeduld in diversen Positionen (ich konnte nicht mehr liegen, geschweige denn schlafen), beruhigte mich und schaute ständig nach mir. Sie bot mir auch an dafür zu sorgen, dass ich nachts eine Pflegerin bekam und keinen Pfleger (wegen Bettpfanne und so…). Ich erfuhr später, dass die Intensivpfleger/innen im Vergleich zu anderen Kollegen sehr zufrieden mit der Personalstärke ihrer Abteilung waren. Jede/r Pfleger/in betreute zwei Patienten, entsprechend gut war die Pflege. Zur zweiten Intensivschwester komme ich später.
„Mein Zustand verschlechterte sich trotz der guten Intensivbetreuung. Man machte noch einen Versuch und punktierte die Lunge – in der Hoffnung, dass das Erleichterung bringt. Dabei wird mit einer Spritze das Wasser direkt aus der Lunge gezogen. Doch die Verbesserung hielt nur kurz, das Wasser sammelte sich schnell wieder im Hohlraum und mir ging es inzwischen so elend, dass ich extra Sauerstoff durch eine Maske atmen musste und Panikattacken bekam, weil ich so wenig Luft bekam.“
Alle Ärzte an einem Tisch
Dann passierte etwas, das eigentlich Standard sein sollte: Ärzte aller Disziplinen versammelten sich an meinem Bett und berieten, was aus ärztlicher Sicht die beste Lösung ist. Eine Gynäkologin vom PNZ wurde gerufen, die auch stellvertretend für die Kinderärzte teilnahm. Ein Anästhesist war dabei sowie der Lungenarzt und der Kardiologe. Die Ärzte berieten sich auf Augenhöhe mit größtem Respekt voreinander, diskutierten auch „über ihren Tellerrand“. Dabei stach ausgerechnet ein Mediziner hervor, dem man sonst nur eine Nebenrolle zumisst: der Anästhesist. Er moderierte quasi die Runde und schien sich auch interdisziplinär sehr gut auszukennen. Das Fazit: Mein Zustand gab ihnen weiter Rätsel auf, weil er selbst bei Lungenentzündung ungewöhnlich schlecht war. Man vermutete, dass der Körper durch die Schwangerschaft einfach überlastet war (offenbar behandeln die Ärzte auf der Intensivstation nicht so häufig Schwangere). Ich äußerte im Zuge der Diskussion die Sorge, zwischen mir und meinem Baby entscheiden zu müssen.
„Daraufhin sagte mir die Gynäkologin klipp und klar, dass ich das gar nicht entscheiden muss, weil die Ärzte verpflichtet sind, mein Leben einem ungeborenen Leben vorzuziehen. Ich brach natürlich in Tränen aus – wusste aber auch, dass mein Körper am Ende war und wenn nichts getan wird, es sowohl um mich als auch das Baby schlecht bestellt war.„
Den finalen Ausschlag zur Zustimmung, dass Baby per Kaiserschnitt zu holen, gab ein Statement der Gynäkologin: Aus Sicht der Kinderärzte sei es vollkommen egal, ob das Kind heute, in ein paar Tagen oder in der 34. Woche geholt wird. Nahezu alle Babys ab Schwangerschaftswoche 30+0 kommen problemlos. Und so unterschrieb ich benebelt von Medikamenten und dennoch im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte mit wahnsinnig zittriger Hand die Erklärung zum Notkaiserschnitt.
Der Anästhesist als Ruhepol
Es folgte das übliche Anästhesie-Gespräch – mit einer Besonderheit: Der Anästhesist übernahm offenbar die komplette OP-Koordination und eröffnete mir auch, dass man vorsichtshalber Blutkonserven meiner Blutgruppe vorrätig hielt für den Fall der Fälle, dass ich kollabiere. Diese Information sowie alle weiteren Erläuterungen zur OP vermittelte er mit einer solchen Souveränität, dass ich tatsächlich den Eindruck bekam, ein Notkaiserschnitt in meinem Zustand sei für die Klinik das Normalste auf der Welt. Das war es offenbar nicht, denn so viele Ärzte verschiedener Disziplinen waren wohl selten bei einem Notkaiserschnitt beteiligt – und meine Krankengeschichte war hinterher im ganzen Klinikum bekannt.
Ich hatte verstanden, dass das Baby noch am gleichen Tag geholt wird – jedoch erstens nicht bemerkt, dass es inzwischen abends geworden war, und zweitens, dass ein Notkaiserschnitt SOFORT durchgeführt wird. Angesichts meines Zustands blieb da auch kein Spielraum mehr, wie ich im Rückblick erkannt habe. Und so starteten die regulären Notkaiserschnitt-Vorbereitungen, die unter anderem das Legen eines Zugangs am Hals sowie eines Blasenkatheters bei vollem Bewusstsein beinhalteten. Ausreichend Zugänge an den Handgelenken hatte ich bis dahin schon gesammelt. Die ganze Zeit über bis hin zum erste Atemzug des Narkosemittels war der Anästhesist an meiner Seite und schaffte es, mich zu beruhigen und mich fest dran glauben zu lassen, dass alles gut wird. Nebenbei, so erfuhr ich später, kümmerte er sich auch noch um meinen Freund, der natürlich nervlich am Ende war.
Ende gut alles gut? Nicht ganz…
Die OP lief gut, meine Kleine wurde gesund auf die Welt gebracht und konnte dank der Lungenreifespritzen auch gleich allein atmen. Mein Freund sah sie als erstes und konnte wenig später schon mit ihr „känguruhen“. Die angeschlossene Frühchen-Intensivabteilung kümmerte sich ausgezeichnet um die Kleine und um den besorgten Papa.
Ich musste während der OP zwar keine Blutkonserven bekommen, doch war mein Zustand danach noch so instabil, dass man mich mit Medikamenten noch einmal eine Weile ruhigstellte. Das wusste ich nicht, als ich aufwachte – ich war in dem Glauben, dass immer noch der gleiche Tag sei, auch wenn ich mich unbewusst etwas über die angezeigte Uhrzeit wunderte. Tatsächlich war die Geburt am Sonntagabend und ich kam am Montag frühen Nachmittag erst wieder zu mir. Was ich verstanden hatte war aber, dass es dem Baby gutgeht, und das war das Wichtigste. Auch mein Zustand besserte sich rapide. Die Kabelbinder an den Armen, der Beatmungsschlauch, die Magensonde, weitere Schläuche und später auch die extra Sauerstoffzufuhr wurden innerhalb weniger Stunden entfernt. Vom Beatmungsschlauch und der Magensonde hatte ich gar nichts bemerkt in meinem benebelten Zustand, mich allerdings schon etwas gewundert, dass ich am Anfang nicht sprechen konnte. Eine Blutkonserve verabreichte man mir sicherheitshalber aber noch.
Am Abend, als mein Freund und meine Familie weg waren (sie wurden von der Schwester weggeschickt, die ihnen deutlich machte, dass ich sonst nicht zur Ruhe komme), kam dann der Einbruch. Meine Beine begannen wie verrückt zu zittern und ich bekam wieder Panik und Atemnot. Die zweite Schwester kam sofort und ich fragte sie verzweifelt, warum es mir denn wieder schlecht geht, wo doch wieder alles gut ist.
„Sie sagte so etwas wie: „Meine Liebe, bei dem was Sie durchgemacht haben, ist das doch kein Wunder. Geben Sie sich etwas Zeit.“ Das sagte sie so verständnisvoll und voller Respekt, dass ich mich direkt wieder beruhigt habe. Trotzdem konnte ich auch in dieser Nacht wieder nicht schlafen. Die Pflegerin bemerkte das und fragte mich, was denn los sei. Ich konnte es ihr nicht sagen. Da nahm sie mich in den Arm und sagte „Lassen Sie es einfach raus“.“
Und endlich realisierte ich, was da eigentlich mit mir passiert war – und wie schlimm es trotz der Tatsache, dass es dem Baby gutging, war, dass mein Bauch leer und mein Baby nicht bei mir war. Später sagte die Schwester auch noch zu mir: „Und wehe, sie machen sich Vorwürfe wegen des Kaiserschnitts. Sie haben nicht versagt, ich hatte auch einen Kaiserschnitt und alles ist gutgegangen. Jeder, der ihnen da ein schlechtes Gewissen machen will, hat keine Ahnung.“ Die Schwester versorgte mich auch mit gekühltem Birnengläschen und Capri-Eis – wegen beanspruchter Atemwege (Beatmungsschlauch) und unstillbarem Durst (ich durfte noch nicht so viel trinken, wie ich wollte) das leckerste, was ich je gegessen habe. Dank dieser Schwester hatte ich am nächsten Tag wieder neuen Mut, mein Gesundheitszustand wurde in Rekordzeit besser, weil ich mein Baby sehen wollte.
„Man muss dazu sagen, dass die Ärzte von der Intensivstation wirklich versuchten, mich so schnell wie möglich mit meinem Baby zusammenkommen zu lassen. Sie prüften die verschiedenen Optionen – das Baby zu mir zu bringen oder mich zum Baby. Doch das Risiko von Keimen war zu groß und so musste ich warten, bis mein Kreislauf wieder mitspielte.“
Am Dienstagnachmittag war es dann so weit: Mit Rollstuhl, Blasenkatheter, Krankenhaushemdchen und Antibiotika-Tropf konnte ich mein Baby das erste Mal in den Arm nehmen. Ob ich noch am gleichen Tag auf die Wochenbettstation umziehen durfte, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall erinnere ich mich noch, dass der Kardiologe, der mich zuerst untersucht hatte, sowie auch ein Kollege, der sich nach der OP um mich kümmerte, noch einmal zu mir kamen. Sie wollten wissen, wie es mir und meiner Tochter geht und erzählten mir, dass sie immer noch darüber rätselten, warum es alles kam, wie es kam. Der erste Kardiologe holte mich nach einer regulären Nachuntersuchung noch einmal zu sich, um wirklich sicherzugehen, dass da nichts übersehen wurde und die Organe wieder einwandfrei funktionierten. Durch das Entwässerungsmedikament wurde das Wasser nach und nach aus meiner Lunge gedrückt, die Sauerstoffsättigung normalisierte sich – auch wenn ich wohl zu den Menschen gehöre, die trotzdem sie Nichtraucher sind auch im Normalzustand keine 100% schaffen.
„Eine weitere Erinnerung habe ich an eine Nachtschwester der Intensivstation. Ich hatte eine große Gier nach etwas zu trinken mit Geschmack, nicht nur Wasser, und fragte sie nach Schorle. Sie kam zurück und sagte entschuldigend, dass auf Station leider keine Schorle sei, sie mir aber gerne von ihrer Schorle etwas abgibt, die sie sich mitgebracht hat. Ich wiegelte ab, doch sie bestand darauf. Über solche vermeintlichen Kleinigkeiten war ich so dankbar – und sie taten so gut.“
Ich wurde noch eine Woche auf der Wochenbettstation versorgt, wo die Schwestern allerdings etwas überfordert mit meiner unüblichen umfangreichen Nachsorge waren. Auch nach meiner Entlassung war ich jeden Tag im Klinikum auf der Frühchenstation und besuchte auch meine ehemalige Bettnachbarin, die wegen verkürztem Gebärmutterhals insgesamt acht(!) Wochen auf der Station der Risikoschwangeren verweilen und hat sich jederzeit gut aufgehoben und versorgt fühlte. Auch ich fühlte mich im Klinikum schon fast wie zu Hause, da ich dort seit unserem Umzug fast mehr Zeit verbracht hatte als zu Hause und viele Pflegerinnen kannte – eine völlig neue Krankenhauserfahrung.
„Immer, wenn ich jetzt das Gebäude des Klinikums sehe oder daran vorbeispaziere, spüre ich Dankbarkeit und habe ein gutes Gefühl. Ich habe Ärzte, Hebammen und Pfleger kennengelernt, für die der Beruf eine Berufung ist und der Patient keine Nummer; die sich auch in der Pause noch Gedanken um die Patienten machen und ein richtiges Team sind.“
Selbst auf den Stationen, die pflegerisch unterbesetzt waren (was ich hier gar nicht verschweigen will), war der Zusammenhalt sehr gut und es wurde sich auch nach Feierabend verabredet. Mit diesem Text möchte ich zeigen, dass es auch in einem „kommerzialisierten“ Klinikkonzern, auf denen sonst immer nur rumgehackt wird, große Menschlichkeit gibt – eben weil auch dort Menschen arbeiten, die ihren Job mit Herz und Verstand machen.
Über FrischgebackeneMama
Ich bin 31 Jahre alt, Wahlhamburgerin und seit Juni 2016 Mutter einer kleinen Tochter, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Jetzt weiß ich, dass Mutter sein anstrengender als ein Vollzeitjob und Elternzeit kein Sabbatical ist – selbst wenn man nicht bastelt und Brot selbst backt. Vor meiner Elternzeit habe ich ein Team aus Beratern und Redakteuren in einer mittelständischen „Kommunikationsberatung“ geleitet – also einer PR-Agentur. Dorthin kehre ich im Sommer 2017 zurück. Davor ist noch eine zweimonatige Europatour mit dem Wohnmobil geplant. Im Web bin ich zu finden auf Twitter unter „FrischgebackeneMama“ (@NeueMama). Über einen eigenen Blog habe ich nachgedacht, konnte mich aber bisher noch nicht dazu entschließen.


Super toll geschrieben, ich habe Tränen in den Augen. Auch wenn der Verlauf nicht wie geplant war, es ist wirklich ganz toll zu lesen das das ganze Team so klasse miteinander gearbeitet hat und es Allen wieder so gut geht. Liebe Grüße, Nicole.
WOW!
Das ist echt schlimm und sehr positiv zu gleich. Schön, dass du alles gut überstanden hast. *schnief* Ich musste jetzt schon sehr damit kämpfen, nicht loszuweinen. Meinen vollen Respekt.
Danke Yasmin, dass du diesen Beitrag als Gastbeitrag gepostet hast.
Lg Mel
wow!
ich möchte lediglich anmerken, dass ein mrt (im gegensatz zu ct und röntgen) in der schwangerschaft gemacht werden kann, da bei einer magnetresonanztomographie eben keine strahlung genutzt wird.